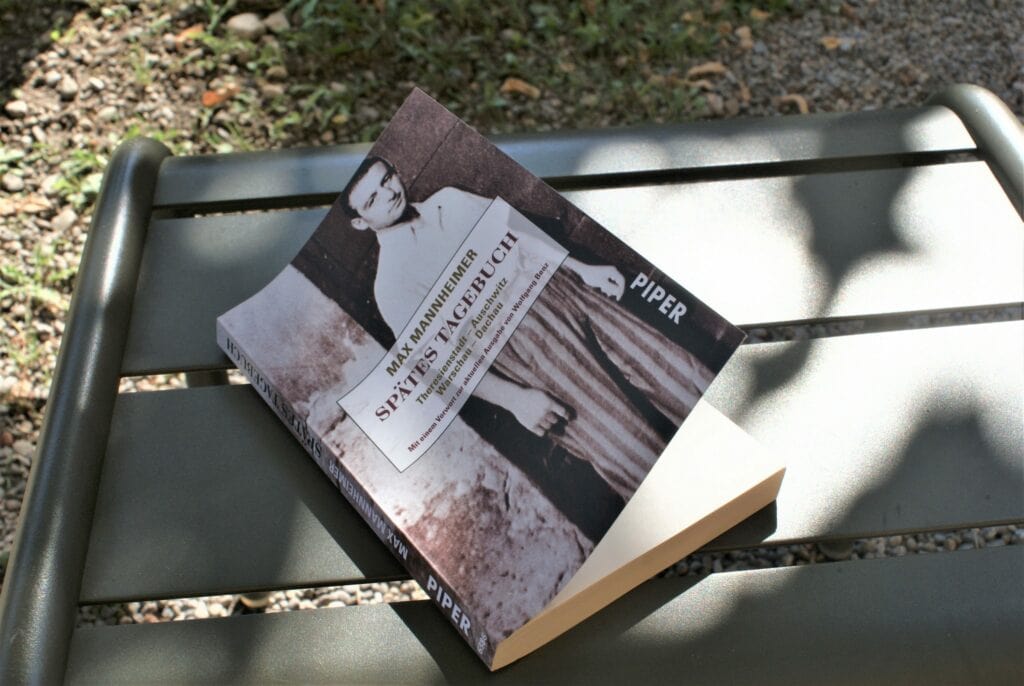Max Mannheimer wurde 1920 in Neutitschein (Tschechoslowakei) geboren. In seinem “Späten Tagebuch” schildert er seine Erinnerungen an Theresienstadt, Auschwitz, Warschau und Dachau. Ursprünglich für seine Tochter Eva, für die er sie Ende 1964 zu Papier brachte, nachdem seine zweite Frau gestorben war.
An eine Veröffentlichung hatte Max Mannheimer über 20 Jahre nicht gedacht. Dann stieß Barbara Distel, die damalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, 1985 bei der Vorbereitung der Dachauer Hefte auf sein Typoscript stieß. Seit dem Jahr 2000 wird seine Geschichte immer wieder als Buch gedruckt.
Die derzeitige Ausgabe hat 144 Seiten und ist in sechs Kapitel unterteilt. Hinzu kommt ein 12-seitiges Vorwort des Historikers Wolfgang Benz, in dem die Leser*innen mehr über den Verfolgten, Maler und Zeitzeugen Max Mannheimer erfahren. Außerdem gibt es erklärende Anmerkungen, eine kurze Bibliografie und ein Nachwort von Ernst Piper.
“Spätes Tagebuch” von Max Mannheimer
Kapitel 1: Jugend in Neutitschein
In Kapitel 1 erzählt Max Mannheimer, wie sich seine Eltern kennengelernt haben. Ferner berichtet er von seiner Kindheit und Jugend in Neutitschein (Tschechoslowakei), während der er erkennt, dass seine Familie anders ist als die der anderen Volksschüler: jüdisch.
Erste Anzeichen des Nationalsozialismus bemerkt Max Mannheimer bereits in den Jahren 1934 bis 1936 auf der Handelsschule. Jedoch sieht er die drohende Gefahr nicht. Dies ändert sich, als Hitler im März 1938 in Österreich einmarschiert und sich seine Truppen in unmittelbarer Nähe befinden. Schließlich besetzen die Nazis auch das Sudetenland. Daraufhin ändert sich das Leben in Neutitschein radikal. Überall prangen Hakenkreuze. Viele deutsche Kunden weigern sich fortan, in jüdischen Geschäften einzukaufen. Am 10. November kommt es auch in einem Teil der Tschechoslowakei zu Pogromen, jüdische Männer werden verhaftet.
Kapitel 2: Ungarisch-Brod
Ende Januar 1939 zieht die Familie Mannheimer nach Ungarisch-Brod. Sie hofft dort auf ein angstfreies Leben. Nur wenige Wochen später marschieren auch in Ungarisch-Brod deutsche Truppen ein. Da Juden nur noch erlaubt ist, manuelle Tätigkeiten zu verrichten, kann Max nicht mehr in seiner Gewürz- und Sammenhandlung arbeiten. Deshalb heuert er beim Straßenbau an. Eine Arbeit, die ihm durchaus gefällt, da er “was sieht”.
In Ungarisch-Brod lernt Max Mannheimer Eva Bock, seine erste Liebe, kennen. Beide heiraten im September 1942. Obwohl der Bruder von Max zu dem Zeitpunkt bereits in Haft ist, unterschätzt der Rest der Familie die immer größer werdende Gefahr. Schließlich erhalten alle Familienmitglieder die Aufforderung, sich am 27. Januar 1943 in einer Schule in Ungarisch-Brod einzufinden. Nur einen Tag später folgt der Transport nach Theresienstadt.
Kapitel 3: Theresienstadt
Das Kapitel über Theresienstadt hat nur wenige Seiten. Theresienstadt ist für die Familie nur eine Durchgangsstation für den angeblichen “Arbeitseinsatz im Osten”. Sehr schnell merken Max und seine Angehörigen, dass es sich bei ihrem Ziel um Auschwitz-Birkenau handelt. Seine Frau Eva sieht Max an der Todesrampe zum letzten Mal.
Kapitel 4: Auschwitz-Birkenau
Der Station Auschwitz-Birkenau sind im Buch über 40 Seiten gewidmet. Sehr eindrucksvoll schildert Max Mannheimer Selektionen, gnadenlosen Drill, Misshandlungen, Hunger und Überlebensstrategien:
“Auch an Schläge kann man sich gewöhnen. Bei unserer Rückkehr wartet der Lagerkapo auf uns. (…) Er hat sich ein seltsames Spiel ausgedacht. Spießrutenlaufen. Mit dem Kies. Zwei Reihen Häftlinge, ungefähr zehn auf jeder Seite, stehen mit dem Gesicht zueinander. In den Händen halten sie Schaufelstiele. Die übrigen müssen durchlaufen. Und müssen geschlagen werden. Ich werde den Schlagenden zugeteilt. Ich hole zum Schlag aus, ohne in Wirklichkeit zu schlagen. Ich bemerke nicht, daß mich der Kapo beobachtet. Unter seinem Schaufelstiel breche ich zusammen.”
Seinen 23. Geburtstag hat Max im Lager:
“Heute bin ich dreiundzwanzig. Meine Brüder gratulieren. Nächsten Geburtstag in Freiheit! Die Freunde schließen sich an. Ich habe Mühe, die Tränen zu unterdrücken. Härte macht nicht hart. Zumindest nicht mich.”
Am 5. Oktober 1943 soll Max Mannheimer von seinem letzten Bruder getrennt werden. Um nicht allein zurückzubleiben, meldet sich Max trotz einer größeren Wunde als arbeitsfähig. Seinen Bruder darf er daher zu einem Arbeitseinsatz ins Warschauer Getto begleiten.
Kapitel 5: Warschau
Im Warschauer Getto müssen die beiden Brüder Abbrucharbeiten verrichten. Danach meldet sich Max als Wäscher. Dies hat unter anderem den Vorteil hat, dass Max auch seine eigene Kleidung unbemerkt waschen kann.
Dass die Befreiung naht, sickert auch bis zu den Häftlingen durch. Schließlich müssen sich alle auf einen Fußmarsch gen Westen begeben:
“Hunger und Durst plagen uns. Wir kommen nach Sochaczew. Ein Fluß. Trotz Typhusgefahr trinken wir. Wir können nicht anders. Mit und ohne Kaulquappen.”
In Kutno verlädt die SS die Gefangenen in Waggons und transportiert sie nach Dachau.
Kapitel 6: Dachau
Im August 1944 kommen Max und sein Bruder Edgar im Konzentrationslager Dachau an. Nach drei Wochen Quarantäne geht es weiter ins KZ-Außenlager Karlsfeld. Max Mannheimer wird einem Außenkommando zugeteilt, in dem er auf dem Gelände von BMW Hallen bauen soll. Er schleppt vor allem Zement. Als Max dort krank wird, muss er nur noch ‘leichte’ Arbeiten übbernehmen:
“Leicht? Zusammen mit einem sehr alten Häftling (…) transportiere ich mit einem Muli Leichen von Karlsfeld nach Dachau. Ins Hauptlager. Zur Verbrennung. (…) Ich habe darauf zu achten, daß die Toten zugedeckt bleiben. (…) Leichen aus dem KZ sind kein schöner Anblick.”
Im Januar 1945 kommen Max und Edgar im Lager Mühldorf am Inn an. Die SS räumt das Lager am 28. April 1945. Zwei Tage später befreit die US-Army die beiden Brüder.
“Spätes Tagebuch” von Max Mannheimer: meine Meinung zum Buch
Nachdem ich begonnen hatte, das Buch zu lesen, konnte ich es nicht mehr aus der Hand legen! Mit seinen kurzen, oft ellipsenartigen Sätzen schildert Max Mannheimer seine Erlebnisse während der NS-Zeit sehr eindrucksvoll. 14 Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen Max und seine Familie. Das Buch ist ein Muss für alle, die mehr über die Shoah erfahren möchten.
Mannheimer, Max: Spätes Tagebuch – Theresienstadt – Auschwitz – Warschau – Dachau – Mit einem Vorwort zur aktuellen Ausgabe von Wolfgang Benz. München/Berlin, 20166, ISBN 978-3-492-26386-3, 144 Seiten