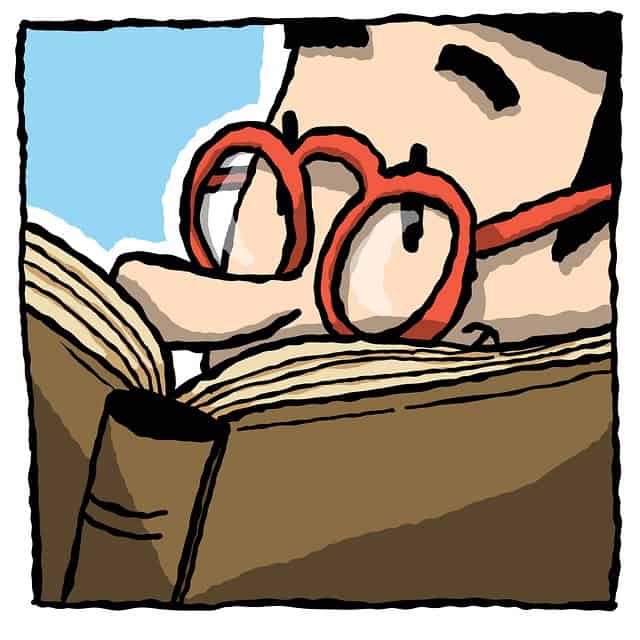Um Texte lesen und verstehen zu können, müssen Leser*innen viele verschiedene Voraussetzungen mitbringen. In diesem Beitrag erfährst du, welche Anforderungen durchschnittliche Texte an ihre Leser*innen stellen und auf welchen Ebenen es Leseprobleme geben kann. Außerdem verrate ich dir, wie du Texte für Menschen mit Leseproblemen schreibst und aufbereitest.
Welche Anforderungen stellen Texte an ihre Leserschaft?
Informationen mit den Augen wahrnehmen
Leser*innen müssen Informationen zunächst einmal mit ihren Augen aufnehmen. Verarbeiten können sie nur, was sie während des Leseprozesses wahrnehmen. Beim Lesen bewegen sich die Augen in Sprüngen über den Text. Meist springt das Auge beim Leseprozess vorwärts. Wenn es jedoch zu Leseproblemen kommt, sind auch „Rückwärtssprünge“ erforderlich. Nach rückwärts muss sich das Auge zum Beispiel bewegen, wenn Sätze zu lang oder unübersichtlich sind. Oder wenn Bezüge unklar bleiben und Wörter zu viele Buchstaben haben. Statt sich von einem Punkt zum nächsten zu bewegen, kommt es zu sogenannten Fixationen, bei denen das Auge zum Beispiel versucht, ein längeres Wort zu entziffern.
Geübte Leser*innen springen seltener nach rückwärts. Sie erkennen häufig auftretende und in einem bestimmten Kontext zu erwartende Wörter schnell. Andere Wörter, wie Artikel, nehmen flüssige Leser*innen sogar aus dem Augenwinkel wahr. Sie müssen diese Wörter nicht eigens fixieren.
Wörter entziffern und zu Sinneinheiten zusammensetzen
Die Hauptzielgruppe Leichter Sprache dagegen liest in der Regel wenig, auch wenn ich persönlich tatsächlich einige wenige Personen mit einer leichten geistigen Behinderung kenne, die relativ viel lesen. Die meisten Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen über eine geringe Lesepraxis. Wie andere ungeübte Leser*innen entziffern sie Sätze recht mühevoll Wort für Wort, Wörter teils Buchstabe für Buchstabe. Anschließend versuchen sie, die gelesenen Wörter zu Sinneinheiten zusammenzusetzen und in den Kontext einzuordnen.
Beim Lesen ein Satz- und Textverständnis ausbilden
Bei ungeübten Leser*innen nimmt das Lesen viel Zeit in Anspruch. Die Zahl der pro Minute gelesenen Wörter verringert sich im Vergleich zu geübten Leser*innen erheblich. Leser*innen mit einer hohen Lesekompetenz erreichen pro Minute 200 bis 300 Wörter, mit Schnell-Lesetechniken sogar 800 bis 1500. Ungeübte Leser*innen kommen pro Minute dagegen auf nur 5 bis 100 Wörter. Wie schnell du liest, kannst du online testen.
Vielleicht hast du schon einmal mit Kindern das Lesen geübt. Dann ist dir sicher auch aufgefallen, wie sehr Leseanfänger*innen am Anfang ins Stocken geraten! Bei ungeübten erwachsenen Leser*innen ist das ähnlich. Wenn du Lesebeginner*innen fragst, was sie gerade gelesen haben, haben sie darauf auch oft keine Antwort. Häufig haben Lesebeginner*innen jedes einzelne Wort zwar richtig entziffert und verstanden. Es ist ihnen jedoch nicht möglich, die Aussage eines längeren Satzes oder Textes wiederzugeben. Grund hierfür ist, dass alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für das Entziffern und Verstehen der Einzelwörter benötigt wurde. Kapazitäten für das Satz- oder Textverständnis sind nicht mehr vorhanden.
Gelesene Wörter im Arbeitsgedächtnis abspeichern
Wer Wörter gelesen hat, speichert sie zunächst im Arbeitsgedächtnis. Ist die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beim Lesen erschöpft, werden die Leser*innen langsamer. Das Abspeichern von Informationen im Langzeitgedächtnis wird unmöglich. Die Hauptzielgruppe Leichter Sprache verfügt nur über ein kleines Arbeitsgedächtnis, das beim Lesen von Texten schnell ausgelastet ist. Bei einigen Menschen mit einer geistigen Behinderung ist dies sogar schon nach einigen Wörtern der Fall.
Gelesenes zu Wissen machen
Ob Leser*innen Wörter und Sätze zu größeren Sinneinheiten zusammenfügen können, hängt stark von zwei Faktoren ab: von der eigenen Lesekompetenz sowie vom Schwierigkeitsgrad des Textes. Vielen Personen fällt es sehr schwer, Sätze sinngemäß aufeinander zu beziehen. Noch schwieriger wird es, das Gelesene als Wissen abzuspeichern.
Wodurch entstehen Leseprobleme?
Probleme beim Lesen durch eine Sehbehinderung
Die Leichte-Sprache-Leserschaft steht beim Lesen in der Regel vor mehreren Problemen. Einige Menschen mit einer geistigen Behinderung sind mehrfachbehindert, zum Beispiel auch sehgeschädigt. Ohne ausreichendes Sehvermögen wird es schwierig, Texte visuell wahrzunehmen. Probleme können zum Beispiel bei unzureichenden Kontrasten oder zu kleiner Schrift entstehen.
Durch schweren Wortschatz beeinträchtigtes Leseverständnis
Zu anderen Leseproblemen kommt es, weil der im Text verwendete Wortschatz nicht bekannt oder zu selten ist. Die Hauptzielgruppe Leichter Sprache benötigt leichte Wörter. Wodurch sich leichte Wörter auszeichnen, kannst du auf meinem Blog in einem eigenen Beitrag nachlesen.
Unbekannte Präteritums-Formen und Leseprobleme
Schwierigkeiten beim Lesen können auch im Mündlichen selten verwendete Verformen (zum Beispiel die Präteritums-Formen mancher starker Verben, wie „buk“ oder „trug“) verursachen. Über solche Formen „stolpern“ sogar Gymnasiast*innen mit Muttersprache Deutsch noch in der Unterstufe, wenn sie nur wenig lesen (oder ihnen nur wenig vorgelesen wird) und ihnen diese Formen daher nicht aus Kinderbüchern oder Märchen bekannt sind. Leichte Sprache verwendet deshalb in der Vergangenheit (fast nur) Perfekt.
Grammatik und fehlendes Texsorten-/Textmusterwissen
Andere Lesehürden entstehen durch bestimmte grammatikalische Strukturen.
Wenig-Leser*innen verfügen außerdem über ein geringes Textsorten- beziehungsweise Textmusterwissen. Damit es möglich ist, über Texte zu kommunizieren, brauchen Ersteller*innen und Leser*innen von Texten ein bestimmtes Wissen über Textstrukturen. Textsorten unterliegen gewissen Konventionen, also Regeln, die nicht allen bekannt sind. Wenn ein Text zum Beispiel mit „Es war einmal“ beginnt, ist dies ein Hinweis auf ein Märchen. Steht am Anfang eines Textes jedoch „Im Namen des Volkes“, handelt es sich um ein Gerichtsurteil. Verträge wiederum weisen eine Struktur mit mehreren Paragrafen auf, viele Gedichte bestehen aus Versen und Reimen (nicht alle). Wer ein Gerät für die eigene Küche auspackt, findet beim Auspacken auch eine Gebrauchsanleitung, die wiederum auf eine bestimmte Weise aufgebaut ist.
Fehlendes Themen-Vorwissen sorgt für Leseprobleme
Menschen, die wenig lesen und die sich auch anderweitig wenig informieren (können), besitzen auch oft nicht das für bestimmte Themen nötige Vorwissen – ein Punkt, warum KI sich beim Erstellen von Leichte-Sprache-Texten so schwertut und es Leichte Sprache nicht auf Knopfdruck gibt.
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind bei standarddeutschen Texten mit einer Vielzahl an Leseeinschränkungen konfrontiert, die ihnen das Lesen und Verstehen des Textes unmöglich machen. Sie verfügen nur über einen sogenannten Kernwortschatz, haben kein oder nur wenig Textsortenwissen und selten ein themenspezifisches Vorwissen. Weitere Einschränkungen können dazukommen.
Leseprobleme durch geistige Behinderung, LRS und Legasthenie
Für Menschen mit einer geistigen Behinderung müssen Texte stark vereinfacht werden und besonders lesefreundlich sein. Durch die starke Textoptimierung sind Leichte-Sprache-Texte für andere Leser*innen viel zu einfach – auch für Menschen, die erst seit kurzem Deutsch lernen, oder für Personen, die nur stockend lesen. Bei einer starken Leseschwäche, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder einer Legasthenie ist das Lesen und Schreiben zwar erschwert, aber die Intelligenz nicht beeinträchtigt. Viele Menschen mit LRS oder Legasthenie sind sogar überdurchschnittlich intelligent und brauchen die kleinschrittigen Erklärungen Leichter Sprache nicht. Leichte Sprache erleichtert dann zwar unter Umständen den Einstieg beim Lesen, auf Dauer geeignet ist sie nicht. Das braucht sie auch nicht, denn eine geeignete Therapie kann Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben für Betroffene mit Leseschwäche, LRS oder Legasthenie deutlich verringern.
Wie du Texte für Menschen mit Leseproblemen schreibst
Wie du Texte für Menschen mit einer unterdurchschnittlichen Lesefähigkeit schreibst, erfährst du jetzt. Menschen mit Demenz und einer geistigen Behinderung benötigen in der Regel Leichte-Sprache-Texte. Für andere Personen mit Leseproblemen beziehungsweise einer Leseschwäche reichen lesefreundliche Texte in Einfacher Sprache, oft ist Leichte Sprache Plus am besten.
Sorge für eine gute Lesbarkeit deines Textes
Generell profitieren alle Leser*innen davon, wenn Texte so aufbereitet sind, dass sie visuell gut wahrnehmbar sind:
- Buchstaben müssen klar erkennbar und deutlich unterscheidbar sein. Feine Strichstärken und geschlossene Buchstabenformen erschweren die Lesbarkeit. Für Menschen mit Sehbehinderungen sind humanistische serifenlose Schriften am besten zu lesen. Zwischen den einzelnen Buchstaben ist für eine gute Leserlichkeit ein ausreichender Abstand wichtig. Ein Indikator, ob eine Schrift gut lesbar ist, ist zum Beispiel, ob sich a und o klar voneinander unterscheiden lassen.
- Eine große Schriftgröße sorgt für eine gute Lesbarkeit. Informationen über Mindestgrößen findest du hier.
- Für die gute Lesbarkeit deines Textes sind auch optimale Kontraste wichtig. Den besten Kontrast bietet schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Wenn dein Kontrastverhältnis bei mindestens 4,5 : 1 liegt, bist du auf der sicheren Seite. Einen Kontrastrechner findest du hier. Vermeide bitte auch, Schriften auf unruhige Hintergründe zu setzen. Einzelne Buchstaben oder ganze Wörter können dann nicht mehr entziffert werden.
- Wörter in durchgängiger Großschreibung, mit Sperrdruck oder in Kursivschrift sind schlecht lesbar. Sie sind in gut lesbaren Texten ein No-Go.
- Worttrennungen stören den Lesefluss und das Textverständnis.
- In Leichter Sprache darf es pro Zeile nur einen Satz geben. Die einzelnen Zeilen sollten kurzgehalten sein.
- Ein Zeilenabstand von mindestens 1,5 sorgt für eine gute Lesbarkeit. In Leichter Sprache ist dieser Mindestabstand obligatorisch, damit es keine Leseprobleme gibt.
- Denk bei jedem Text an genügend Absätze, freie Zeilen und Zwischenüberschriften. Auch für geübte Leser*innen werden Texte so übersichtlicher.
- Flattersatz ist besser als Blocksatz, weil er zwischen den einzelnen Wörtern für einen gleichmäßigen Abstand sorgt. Blocksatz ist in Leichter Sprache verboten.
Vermeide Leseprobleme, indem du auf die Verständlichkeit deines Textes achtest
Wie Texte für Menschen mit Leseproblemen schreiben? Die Verständlichkeit deines Textes hängt vor allem von der Länge deiner Wörter und Sätze ab. Je kürzer und häufiger deine Wörter, desto bekannter, lesbarer und verständlicher sind sie. Wenn du trotzdem Fachwörter benötigst, solltest du sie immer erklären. Fachwörter kannst du nur bei Fachpublikum voraussetzen.
Zusätzlich solltest du Vorgangspassiv und Nominalstil vermeiden. Nominalstil ist für alle Menschen schwierig – außer für die Person, die ihn „fabriziert“ hat und weiß, was sie damit ausdrücken wollte.
In Leichter Sprache solltest du zusätzlich auf weitere Regeln achten: Leichte Sprache formuliert zum Beispiel möglichst immer positiv und verwendet für gleiche Dinge immer die gleichen Wörter.
Wie verständlich dein Text ist, kannst du mit automatisierten Tools messen. Viele Dienstleister*innen, die Texte in Leichter und Einfacher Sprache erstellen, arbeiten außerdem mit Prüfgruppen zusammen. Ich persönlich mit Henri, Maik und Anna. Meine besten Tipps zur Zusammenarbeit mit Prüfer*innen findest du hier.
Und nun? Auf zum nächsten verständlichen Text!
Du möchtest ihn nicht selbst schreiben? Du hättest gern, dass sich ein Profi deinen leicht verständlichen Text anschaut? Du willst sicher sein, dass dein Text lesefreundlich ist und nicht für Leseprobleme sorgt?
Illustration: Richards Drawings